 Unser westliches Denken geht immer mehr ins Detail. Würde uns aber ein Blick auf das Ganze in vielen Situationen nicht viel mehr helfen? In ihrem beeindruckenden Werk „The Bond“ erläutert die Wissenschaftsautorin unter anderem, wie anders Japaner oder Moken, ein indogenes Volk in Thailand, unsere Welt sehen.
Unser westliches Denken geht immer mehr ins Detail. Würde uns aber ein Blick auf das Ganze in vielen Situationen nicht viel mehr helfen? In ihrem beeindruckenden Werk „The Bond“ erläutert die Wissenschaftsautorin unter anderem, wie anders Japaner oder Moken, ein indogenes Volk in Thailand, unsere Welt sehen.
Die Moken und der Tsunami
Als im Dezember 2004 der Tsunami mit drei 25 Meter hohen Wellen den Strand von Bon Yai auf der thailändischen Insel Surn Tai (Südinsel) verwüstete, beobachteten die Angehörigen des Stammes der Moken, eine kleine, nomadisch lebende Gemeinschaft von Fischern, die Zerstörung ihres Dorfes und den Tod und den Tod von 24 000 Menschen vom höchsten Punkt eines Hügels auf der Insel. Die Stammesältesten hatten ihre Leute gewarnt, und alle bis auf einen behinderten Jungen hatten sich rechtzeitig vor den Wellen in Sicherheit bringen können. Als der Tsunami Richtung Norden raste, wo er die Andaman- und Nikobarinseln und Südindien erreichte, waren alle 250 Mitglieder des alten Stammes der Jarawa, die auf der ansonsten unbewohnten Insel Jirkatang leben, bereits in den Balughatwald geflohen. Nachdem sie sich dort zehn Tage von Kokosnüssen ernährt hatten, kamen sie unversehrt wieder hervor.
Alle Mitglieder der anderen vier Stämme von Ureinwohnern auf den Ansamanen und Nikobaren – die Onges, die Anamnesen, die Nikobaresen und die Rhomben – hatten ebenfalls die Vorzeichen erkannt und sich in Sicherheit gebracht: Normalerweise wären sie um diese Zeit zum Fischen draußen auf dem Meer gewesen. Als ein indischer Hubschrauber über der Insel kreiste, war ein nackter Nikobarese so verärgert über die unnötige Störung, dass er nach seinem Bogen griff und einen Pfeil auf den Helikopter abschoss.
Auf die Frage, woher sie gewusst hätten, dass der Tsunami nahte, zuckte ein Ältester der Jarawa mit den Schultern. Es war offensichtlich. Einer der kleinen Jungen des Stammes hatte sich benommen gefühlt. Der Wasserspiegel des Bachs in der Nähe ihres Dorfes war plötzlich gesunken. Einem der Männer des Stammes waren ein paar geringfügige Unterschiede zwischen verschiedenen Wellen aufgefallen. Sie hatten bei den kleineren Säugetieren eine ungewöhnliche Unruhe und Streitsucht bemerkt, und die Schwimmmuster der Fische im Wasser waren etwas anders als sonst gewesen. Als Kind hatte der Älteste gelernt, auf solche subtilen Signale zu achten. Sie warnten vor Beben der Erde und des Meeres, das sich mit großer Gewalt ausbreiten würde. Der Älteste sah darin Zeichen, dass die Erde und das Meer «zornig» waren und seine Leute in höher gelegene Regionen fliehen sollten.
Eines der vom Tsunami am schlimmsten betroffenen Gebiete war der Gala Nationalpark, das größte Naturschutzgebiet in Sri Lanka, wo sich die Flutwellen bis zu drei Kilometer weit ins Land wälzten. Aber Ravi Corea , der Präsident der Sri Lanka Wildlife Coservation Society berichtet, dass von den zahlreichen Tieren im Reservat nur zwei Wasserbüffel starben. Hunderte von Elefanten, Leoparden, Tigern, Krokodilen und kleinen Säugetieren konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.
Dass so viele wilde Tiere und Gruppen von Ureinwohnern davongekommen sind, ist verschiedentlich darauf zurückgeführt worden, dass sie über ein ausgezeichnetes Gehör verfügen, eine «seismische» Begabung haben, die ihnen erlaubt, die Vibrationen von Erdbeben wahrzunehmen, oder sich ein ursprüngliches Verständnis für die subtilen Veränderungen von Wind und Wasser bewahrt haben. «Sie können den Wind riechen» sagt Ashish Roy, Rechtsanwalt und Umweltaktivist, über die Ureinwohner der Inseln. «Vom Geräusch ihrer Ruder können sie auf die Tiefe des Meeres schließen. Sie haben einen sechsten Sinn, der uns fehlt.»
Aber eine andere Möglichkeit klingt noch außergewöhnlicher: Es gibt einen enormen Unterschied zwischen ihrem Weltbild und unserem. Ein Jahr vor dem Tsunami war Anna Gislén, eine auf die Biologie des Auges spezialisierte Wissenschaftlerin der Lund-Universität in Schweden, fasziniert gewesen, als ein Kollege ihr erzählt hatte, die Seezigeuner, wie die Moken von Außenstehenden oft genannt werden, hätten die außergewöhnliche Fähigkeit, auf dem Meeresboden Nahrung zu sammeln. Sie könnten sogar mit bloßem Auge unter Wasser kleine braune Muscheln von braunen Steinen unterscheiden. Den meisten Menschen gelingt das nicht einmal mit einer Taucherbrille. weil unsere Augen für das Sehen unter Wasser schlecht gerüstet sind. Draußen an der Luft verdanken wir zwei Drittel der Refraktionskraft unserer Augen der gekrümmten Hornhautoberfläche, und dieser Vorteil geht unter Wasser verloren.
Anna Gislén reiste nach Thailand auf die Surininseln, testete die Kinder der Moken unter Wasser und verglich ihre Sehfähigkeit mit der von europäischen Kindern, die mit ihren Eltern in der Gegend Urlaub machten. Was sie entdeckte, widerlegt die meisten Vorstellungen über die menschliche Biologie. Wenn wir uns im Wasser befinden, versuchen unsere Augen gewöhnlich nicht, sich auf scharfes Sehen einzustellen, und genau das fand Gislén bei den europäischen Kindern bestätigt. Die Kinder der Moken hingegen sahen unter Wasser mehr als doppelt so scharf wie die jungen Europäer.
Ein Mokenkind kann schwimmen, bevor es zu laufen vermag. Es lernt, seine Herzfrequenz unter Wasser zu verlangsamen, damit es länger tauchen kann.
Die Mokenkinder trainieren ihre Augen, um die Anpassungsreaktion an die verschwommene Unterwasserwelt zu verbessern, indem sie ihre Pupillen auf einen Durchmesser verengen, der 0,7 Millimeter kleiner ist als bei den Europäern. Dadurch verbessert sich die Tiefenwahrnehmung – «derselbe Prozess, mit dem man die Tiefenschärfe bei einer Kamera mit einer kleineren Blende verbessert», stellt Anna Gislén fest. Diese geringfügige Anpassung verbessert die Sehfähigkeit so stark, dass die Moken sogar noch in einer Tiefe von drei bis vier Metern unter Wasser kleine Muscheln und Seegurken erkennen können.
Die Moken haben gelernt, in jeder Beziehung mit besseren Augen zu sehen. Sie haben ihre Augen in Kameras verwandelt, bei denen sie die Blende gezielt verändern können. Dadurch ist es ihnen möglich, Details und Verbindungen zu erkennen, die wir überwiegend nicht mehr wahrnehmen.
Sie sehen den Raum zwischen den Dingen.
Der japanische Blick aufs Ganze
Stellen Sie sich vor, wie zwei Studenten, einer aus Japan und der andere aus den USA, sich im Louvre durch die Menschenmenge drängen, um schließlich vor dem Bild der «Mona Lisa» zu stehen, die dort hinter kugelsicherem Glas in einer klimatisierten Kabine hängt. Der Amerikaner konzentriert sich sofort auf die Frau selbst und ihre größten Geheimnisse, ihr Lächeln und die Frage, wer sie wohl sein mag: Heute nimmt man an, dass es sich um Mona Lisa Gherardini handelt, die dritte Frau des reichen Seidenhändlers Francesco di Bartolomeo di Zanobi del Giocondo. Der amerikanische Betrachter wird vom Epizentrum des Bildes angezogen, dem Dreieck der Gesichtszüge, in dem die Augen und Lippen der Frau liegen. Er erkennt Leonardos Technik des Sfumato, die Schatten an den äußeren Punkten der Augen, mit denen der Maler bewusst die Emotionen seines Modells verschleiern wollte, und das seltsame Lächeln, das um die linke Seite ihres Mundes spielt. Alle anderen Teile des Gemäldes erscheinen ihm dagegen nebensächlich und könnten genauso gut verschwinden. Gleich, wie lange er darauf starrt, der Amerikaner kann den Wald (den Rest des Gemäldes) nicht integrieren, weil er auf den einzelnen Baum (die Person im Vordergrund) fixiert ist.
Für den Japaner repräsentiert das Gemälde dagegen eine metaphysische Aussage über den Kosmos: Die Verbundenheit von mensch und Natur. Seine Augen wandern hin und her zwischen der Person im Vorder- und der Landschaft im Hintergrund, registriert Details wie die feine Stickerei auf dem schwarzen Schleier der Frau oder die Formen ihrer Gestalt, deren Echo in der kunstvollen Hintergrundlandschaft mit ihren sich windenden Pfaden und Flüssen und einer Andeutung der Brücke von Buriano widerhallt. Ihm fällt auf, dass die Frau überhaupt keinen Schmuck trägt, was zu ihrer Zeit absolut ungewöhnlich war. Eine gute halbe Stunde betrachtet der Japaner das Gemälde aus verschiedenen Winkeln durch seine Finger, benutzt das Papier seines Museumsführers als eine Art Lineal, um herauszuarbeiten, welche Bedeutung die Verletzung der Perspektive und die Variation in der Größe von Mona Lisas Händen haben. Durch seine Art des Sehens verschwinden die Gesichtszüge der Frau vollständig in ihrer Umgebung. Die Person im Vordergrund könnte genauso gut fehlen, so wenig sticht sie für ihn heraus. Mona Lisa kann nicht aus ihrem Kontext herausgelöst werden. Der japanische Student sieht buchstäblich den Baum nicht vor lauter Wald.
Im Unterschied zwischen diesen beiden Studenten gründet ein guter Teil der Karriere von Richard Nistet. Der Professor für Sozialpsychologie an der University of Michigan und Autor des Buchs „The Geography of Thought: How Asians and Westerners Think Differently…and Why“ hat sich sein Leben lang mit der Frage beschäftigt, wie sich kulturelle Einflüsse auf die Methoden des Denkens auswirken. Nistet behauptet, dass Gedankenprozesse und sogar die Wahrnehmung selbst kulturell geprägte Phänomene sind. Menschen in verschiedenen teilen der Erde nehmen die Welt auf unterschiedliche Weise wahr; sie sehen nicht einmal dasselbe. Nisbetts umfangreiche Arbeit auf diesem Gebiet, für das er den Ausdruck «die Geographie der Gedanken» geprägt hat, zeigt klar, dass verschiedene Kulturen sehr unterschiedliche Denkweisen entwickeln, und das beginnt mit der Art und Weise, wie man uns beibringt zu sehen.
Auszüge mit freundlicher Genehmigung des Goldmann Verlags aus:
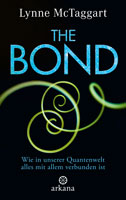
Lynne McTaggart: „The Bond. Wie in unserer Quantenwelt alles mit allem verbunden ist“
Verlag: Goldmann Arkana, 2011
Umfang: 448 Seiten, gebundene Ausgabe
Preis: 19,99 €
ISBN: 978-3442338641
Hier können Sie das Buch bestellen!

2 Kommentare
Ja, unsere Sichtweise und unser so Sein sind von unserer Kultur geprägt. Wäre es nicht schön und wunderbar wenn wir bei der Erziehung und dem Umgang mit anderen Kulturen diese akzeptieren, so sein lassen könnten und diese Vielfalt einfach nur genießen würden? UND, wir würden voneinander beide profitieren; in der kommerziellen Welt nennt man so etwas, eine win-win-situation. Eine wahrlich mystische Welt, voller Wunder!
Danke für den Artikel.
Aber über allen Prägungen steht die geistige Reife des Individuums,
die entweder mehr nach innen oder mehr nach außen orientiert ist.
Daraus wird der Inhalt des visuellen Sehens gespeist.
Denn das Gedankengut jedes Menschen formt seine geistige Umgebung
und umgekehrt formt die geistige Umgebung wieder seine Gedankenkonvolut.
aus der seine Projektionen dann auf das äußerlich Wahrgenommene wirken.
Überwiegt das Äußerliche, geschieht der Seh-Modus analytisch.
Überwiegt das Innere, geschieht der Seh-Modus ganzheitlich.